Mailand, Via Sforza 35, Poliklinik. Ohne Hast schiebt sich ein Rettungswagen durch die engen Gassen des Klinikgeländes, entlang von Besuchern, Ärzten und Pflegern, die zu den verschiedenen Pavillons schlendern – als wäre die Zeit stehengeblieben in diesem Krankenhaus, das zu den ältesten Italiens gehört; 1456 wurde es gegründet. Nichts erinnert an die Hektik, die hier vor wenigen Monaten herrschte: Als Covid-19 die Millionenmetropole erreichte und die Poliklinik in Ausnahmezustand geriet. In der Lombardei wütete das Virus am stärksten: Bis Ende Mai starben in der Region 16 892 Menschen mit einer Infektion. Einziger Infektiologe in seiner Klinikabteilung damals:

Prof. Andrea Gori
Wie wurden Sie von der Pandemie überrascht?
Es war eine Welle. Ich wachte am 1. März auf, las die Nachrichten und dachte: Was ist los? Vorm Krankenhaus warteten hundert infizierte Menschen – die hatten nicht bloß Fieber, die konnten nicht mehr atmen, das war Notstand. Und am nächsten Tag wurden 200 Leute eingeliefert, am übernächsten 300; es war eine Welle nach der anderen.
Was machten Sie?
Ich rekrutierte Freiwillige, vor allem jüngere. Chirurgen, Hautärzte, Studierende – wir mussten funktionieren wie ein Bataillon im Krieg. Da war auch nicht viel nachzudenken. Es ging von Bett zu Bett.
Waren Sie der Kommandant?
(Er lacht.) Nein – ich leitete alles Klinische. Wir Abteilungsleiter des Krankenhauses versammelten uns am ersten Tag und baten unseren Generaldirektor, die Befehlskette sehr gut zu definieren, wie in einer Schlacht. Es musste klar sein: Wer hat was zu sagen? Er bildete einen kleinen Stab, zu dem auch ich gehörte. Jeden Abend kamen wir zusammen und hielten Rat für den kommenden Tag.
Empfanden Sie die Verantwortung als Last?
Nein, denn wir rannten gemeinsam. Jene, die noch nie als Internisten gearbeitet hatten, gingen mit einem Enthusiasmus und einem Ernst ans Werk, wie ich es vorher nie gesehen habe. Mit Demut vor Leid und Tod. Wir hingen alle zusammen: Ärzte, Pfleger, Patienten – ein eigener Kosmos, 24 Stunden am Tag.
Nach Hause gingen Sie nicht?
Nicht zu meiner Frau und meinen Kindern – ich musste sie ja vor mir schützen. Ich arbeitete jeden Tag bis zwei Uhr in der Nacht, ging zu einer kleinen Wohnung, um auszuruhen, und kehrte um sieben in der Früh zurück in die Klinik.
Im Flur des Gebäudes Granelli rutscht eine Frau auf ihrem Stuhl hin und her. „Ich habe solche Angst“, murmelt sie, „solche Angst“. Vielleicht habe sie Corona, raunt sie. An der Rezeption gegenüber schüttelt die Empfangsschwester den Kopf. Die Dame sei wegen etwas anderem hier, erklärt sie, „aber der Schrecken sitzt noch tief.“ Sie meint den Frühling 2020, den die Stadt nicht vergessen wird.
Mit den Ausmaßen hatten Sie selbst auch nicht gerechnet, nicht wahr? Am 20. Februar sagten Sie noch in einem Interview: „Wir sind in der Lage, einer möglichen Epidemie ganz anders entgegenzutreten.“
Nun, ich erwartete, dass ein, zwei Leute mit Fieber auftauchen werden, vielleicht mit Kontakten nach China. Die Notaufnahme hatten wir entsprechend ausgerüstet. Uns traf aber dann nicht der Beginn einer Epidemie, sondern ihr Rückstau. In den zwei Monaten davor hatten sich wahrscheinlich Hunderte oder Tausende Menschen in der Lombardei infiziert – mit milden Symptomen. Wir alle kriegten es nicht mit. Das war der entscheidende Fehler: So erkannten wir die anwachsende Krise nicht, bis sie zu einer eruptiven wurde. Und mit einem Mal mussten wir am Fließband intubieren; darauf waren wir nicht vorbereitet.
Verloren Sie ein Stück weit die Kontrolle?
Nein. Zum einen wandelten wir das Krankenhaus in hoher Geschwindigkeit binnen einer Woche um – im Grunde in ein einziges Feldlazarett. Und zum anderen schotteten wir uns von der Außenwelt ab, als gingen wir in uns selbst, eine Art Blockade. Alles wurde der Lebensrettung untergeordnet. Und was die Patienten brauchten, kriegten sie. In der ersten Woche lag die Sterblichkeit der Patienten in der Reanimation bei 35 Prozent. In der zweiten Woche waren es schon 25 Prozent. Wir funktionierten. Bloß draußen ging vieles schief, da wurde die Epidemie nicht sofort eingedämmt.
Fehlte nichts im Krankenhaus?
Sofort kamen Spenden rein. Eine Mailänder Großbank rief an und sagte: „Was braucht ihr? Wir besorgen es.“ Und sie ließen in drei Tagen einen Container voller Ventilatoren aus China kommen – wir hatten bald auch zu viele, die konnten wir gar nicht alle aufstellen.
Kam es zu Triage?
Nicht bei uns. Fünfzig Kilometer nordöstlich, in Bergamo, schon.
Wie haben die Ärzte dort entschieden?
Aufgrund der errechneten Überlebenschancen, mithilfe der aufgezeichneten Profile und Algorithmen. Es gab keine Auswahl nach Alter oder Behinderung – diese kritischen Fälle waren sämtlich alte Menschen. Bei uns im Krankenhaus aber starb keiner wegen fehlender Beatmungsgeräte oder anderem. Viele konnten einfach nicht mehr, da half auch keine Reanimation. In diesen Fällen mussten wir abwägen: Helfen wir dem Patienten damit, oder verschlimmern wir seine Lage? Und manchmal war es besser, ihn in einen würdevollen Tod zu begleiten, was der Tod in der Reanimation nicht ist.
Nach dem Pavillon Granelli führt eine scharfe Linkskurve zur Klinikkirche. Im Inneren steht ein Pfleger und liest sich die Tageslosung durch. Stumm bewegen sich seine Lippen. Von den bunten Fenstern blicken Figuren von Krankenhausheiligen herab. Der Pfleger schaut kurz aufs Handy und geht langsam hinaus.
Hatten Sie zu Beginn der Pandemie so etwas wie Notfall-Protokolle erstellt?
Ja, aber die waren schnell ihr Papier nicht wert. Ab und zu fluchten wir über diese steten Brüche: Gerade hatte man mit Mühe ein Protokoll in Kraft gesetzt, da musste es schon wieder geändert werden. Aber die Dramatik diktierte auch unsere Gefühle – alles war neu, alle waren unvorbereitet. Was du an einem Tag machtest, galt für den nächsten nicht mehr. Also schluckten wir unseren Frust herunter und versuchten, so effizient wie möglich vorzugehen: Was ist notwendig? Worauf kann verzichtet werden, ohne einen Patienten zu gefährden? Wir konnten uns ja nicht in Teile schneiden.
War das ein Eingeständnis eines Scheiterns?
Nein, jedes Protokoll hatte seinen Sinn zum Zeitpunkt seines Beginns. Klar, wir scheiterten jedes Mal daran, das Protokoll zu erfüllen – aber das lag an den Umständen, nicht an uns. Ein neues Protokoll bedeutete, den Überblick zu bewahren, und das war bei dieser Krise elementar. Scheitern gab es nicht. Wir konnten ja auch nicht einfach nach Hause gehen und sagen: Wir haben verloren. Wohin hätten wir gehen sollen?
Hat der fehlende Schlaf nicht an Ihnen genagt?
Zwei Monate später hatte ich das erste Wochenende frei. Da hab ich 48 Stunden lang geschlafen. In der Krise aber denkt man nicht an Müdigkeit, sondern an das, was man sieht. Das Schlimmste für mich war, mitanzusehen, wie alte Menschen ohne ihre Familien starben. Jeder denkt an den eigenen Tod, bereitet sich irgendwie darauf vor. Und die Familien gehören zum Abschiednehmen dazu – was im Krankenhaus nicht ging. Das war das Brutalste. Die Alten wurden mit dem Rettungswagen abgeholt, und das war’s. Zu Hause wussten die Hinterbliebenen nichts.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Unausgesprochen war uns bei aller Hektik klar: Niemand sollte allein sterben. Wir versuchten das auszugleichen, durch Zuneigung und Nähe, wir ersetzten die Verwandten und Lieben am Sterbebett. Hielten ihre Hände, sprachen mit ihnen. Und verabschiedeten sie.
Zwischen Kirche und Pavillon Granelli ist die Notaufnahme. Vor ihr stehen zwei Dutzend Angehörige, alle im Mindestabstand zueinander. „Wann kommt er endlich wieder raus?“, fragt eine junge Frau ihre Mutter. „Geduld, er hat sich doch nur auf den Daumen gehauen.“ Die Tochter malt mit ihrem rechten Fuß Kreise in den Sand; nebenan wird gebaut. „Ich hasse diesen Ort.“
Was half?
Die Aussicht auf ein Ende. Ab dem 8. März gab es den totalen Lockdown – und in den Tagen danach wurden weniger Neupatienten eingeliefert. Das machte Mut, auch wenn uns im Krankenhaus die schlimmste Zeit noch bevorstand: Die meisten Patienten kämpften viele Tage in der Reanimation um ihr Leben und starben dann in der zweiten Märzhälfte. Ein Lockdown ist extrem, zu dem entschließt man sich, wenn man kapituliert: Wenn klar ist, dass wir anders die Verbreitung nicht kontrollieren können.
Dachten Sie einen Moment lang, dass die Ausmaße noch größer werden, dass man da nicht wieder rauskommt?
Nein. Wir Infektiologen glauben sehr stark an Kontrollmaßnahmen. Auch wenn wir die Folgen einer Viruserkrankung nicht sofort heilen können, wissen wir: Die Kontaktkette der Infektionen muss unterbrochen werden. Und wir wussten auch, dass es präzisere Handlungsanweisungen für die Bürger braucht, damit sie Kontakte vermeiden. Man muss stur seinen Weg gehen und nicht die Nerven verlieren. Zum Glück sahen wir, dass die Leute draußen mitmachten, das hohe Risiko erkannten. Ansonsten hätten wir diese Krise nicht in den Griff gekriegt, dann würden wir uns heute über anderes unterhalten.
Hatten Sie Angst um Ihr Leben?
Nein, aber um das meiner Ärzte. Sie halfen ja aus. Einige von ihnen infizierten sich und erkrankten, durchaus auch schwer, eine Kollegin kämpfte mit einer harten Lungenentzündung. Da litten wir mit. Und es nagte an mir, denn ich hatte sie nicht so geschützt, wie sie hätten geschützt werden -sollen – ich hatte die Verantwortung für sie und sie einem zu hohen Risiko ausgesetzt. Zum Glück überlebten alle.
Die Priester in Ihrem Krankenhaus schrieben am 16. März einen Brief: „Eine Zeit, die offenlegt, was wir wirklich sind.“ Haben Sie etwas über sich gelernt?
Dass man eines Tages aufwacht und sich in einer komplett anderen Welt wiederfindet. Alles, was einem vorher wichtig gewesen ist, kann dort belanglos sein. Mein Leben änderte sich in einer Nacht. Weg von der Familie, auch Angst um meine Eltern. Ich spürte Hilflosigkeit. Also konzentrierte ich mich auf den Schutz jener an meiner Seite. Aber nicht wenige konnten nicht gerettet werden, das ließ in mir große Schuldgefühle aufkommen.
Haben Sie diese Gefühle beiseitegeschoben?
Man muss damit leben. Solche Schuldgefühle stärken auch die Umsicht, ließen mich vorsichtiger in dieser Situation agieren und halfen mir, die Gefahren nicht zu unterschätzen. Prioritäten zu setzen.
Vor dem Pavillon, in einem von einer alten Steinmauer umfassten Garten, sitzen sich zwei Farben gegenüber: Links zwei Pflegerinnen in Grün und rechts zwei Ärztinnen in Weiß; alle vier mit kleinen Espressobechern aus Plastik. „Und was sagte er dann?“, fragt eine von rechts. „Ach, der versuchte nur, süß zu sein“, heißt es von links.
Zogen Sie aus dem Aufwachen aus dieser Nacht auch Positives?
Nichts. Erst später zeigte sich, welch positive Kraft die starke Verbindung ist, die wir Ärzte und Pfleger miteinander eingingen. Das wirkt bis heute. Wie verschmolzen. Das geht nicht mehr weg, das hat uns zu stark geprägt.
Sollten wir alle umsichtiger werden?
Nun, die ganze Welt war auf Corona nicht vorbereitet. Obwohl diese Pandemie vorhersehbar war! Wir alle verschlossen die Augen. Okay, neu ist: Dies ist das erste globalisierte Virus, es verbreitete sich in jener Geschwindigkeit, in der sich heute die Welt dreht – es reiste in riesigen Flugzeugen, nahm teil an Massenveranstaltungen und fuhr weiter in Autos und schnellen Zügen.
Warum waren wir nicht gewappnet?
Der Mensch verdrängt Gefahren. Die Globalisierung ist schneller als wir, da kommen wir mental nicht mit. Selbst jetzt unterschätzen wir noch immer die Gefahren von Covid-19. Ansonsten würden wir unser Gesundheitssystem wirklich ändern, es mit enormen Geldern endlich ausbauen. Unser Konzept von Gesundheit ist veraltet. Gesundheit muss alle Bereiche durchdringen.
Die Sonne neigt sich langsam. Draußen in den Straßen werden die Bars voll, die Leute kommen zum Aperitif zusammen. Und erst, wenn sie sich auf dem Bürgersteig auf ihre Stühle setzen, legen sie die Maske ab.
Copyright Artikelbild: nenovimages / photocase.de


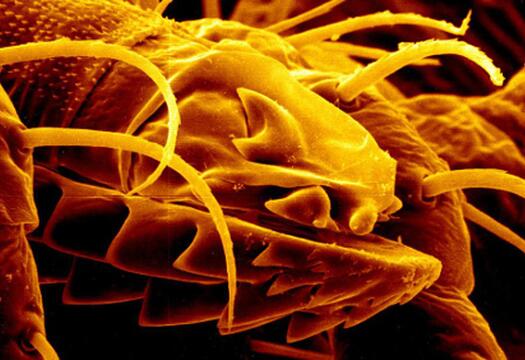


Kommentare