
Trippelschritte, wo es Siebenmeilenstiefel bräuchte: Was mit Blick auf das deutsche Gesundheitssystem nun zu tun wäre. Ein Gespräch mit Prof. Dr. Boris Augurzky, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch und Leiter des Kompetenzbereichs „Gesundheit“ im RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen.
Wir stehen vor riesigen Finanzierungsfragen im Gesundheitssystem – und die Menschen, die es tragen, fühlen sich überlastet, kündigen. Patient:innen fühlen sich derweil oft nicht im Mittelpunkt. Wie sehr kann man bei dieser Ausgangslage das System überhaupt noch weiter „optimieren“?
Prof. Dr. Augurzky: Diese Ausgangslage ist geradezu die Voraussetzung, um eine Optimierung anzupacken. Wenn es uns gut geht, ändern wir uns nicht. So war das in den 2010er Jahren. Allmählich spüren wir aber ganz real die Grenzen unseres Gesundheitswesens: Das Personal wird sichtbar knapp und wir können es auch nicht einfach herbeizaubern. Wir stehen daher an dem Punkt, heilige Kühe zu schlachten und Optimie-rungspotenziale, die es meines Erachtens zuhauf gibt, anzugehen.
Seit Mitte der 1970er folgte Gesundheitsreform auf Gesundheitsreform: Verändern sich die Zeiten derart schnell oder haben die Reformen den falschen Ansatz?
Augurzky: Reformen setzen an einzelnen wahrgenommenen Missständen an und versuchen diese gezielt zu beheben. Manche ökonomischen Anreize werden dadurch neu gesetzt und das System erfährt einen leichten Ruck, der es kurz durchschüttelt. Die Akteure im Gesundheitssystem passen ihr Verhalten an und es entstehen mit der Zeit neue Missstände. In einem regulierten System ist das nicht verwunderlich. Denn Regeln können nie so passgenau sein, dass sie ein für alle Mal ein stabiles System erzeugen.
Freie Märkte regulieren sich über frei schwankende Preise selbst. Im Gesundheitswesen können wir die Preise jedoch nicht freigeben, weil wir sonst den Zugang zu Gesundheitsleistungen nicht für alle Menschen gewährleisten können. Es braucht also regulative Eingriffe, die von Natur aus nie perfekt sind. Hinzu kommt das große Beharren an Besitzständen und dass diejenigen mit den Besitzständen sich politisch besser artikulieren können als die große Masse der Versicherten und Patienten. Das sind die Gründe, weshalb wir immer in kleinen Reformschritten unterwegs sind.
Was ließe sich denn auf Systemebene verbessern?
Augurzky: Zunächst müssten wir besser wissen, welchen Nutzen die einzelnen Leistungen im Gesundheits-wesen bringen. Das geht nur über Daten und Transparenz. Aber genau das scheuen wir wie der Teufel das Weihwasser. Da herrscht eine Haltung von: „Nichts wissen, dann kann man auch nichts falsch machen“. Das haben wir während der Corona-Pandemie schmerzhaft erfahren.
Wir wollen in Deutschland nicht wissen, wie viele Menschen genau geimpft sind. Wir wollen nicht wissen, welche Schutzmaßnahmen wie viel bringen, wir wollen in der Corona-Warn-App nicht wissen, wo genau wir eine Risikobegegnung hatten. Wir leben lieber mit dem Nichtwissen, dann können wir entscheiden, ohne begründen zu müssen.
Die Angst vor Transparenz führt letztlich auch dazu, dass wir immer noch keine etablierte elektronische Patientenakte haben. Sie könnte uns helfen herauszufinden, ob wir die Ressourcen im Gesundheitswesen wirklich sinnvoll einsetzen. Sie könnte uns
Brauchen wir jetzt endlich mal den großen, neuen Wurf?
Augurzky: Das Gesundheitswesen ist superkomplex. Den großen Wurf, mit dem wir ein für alle Mal in einem stabilen System sind, bei dem wir nicht mehr nachjustieren müssen, gibt es nicht. Aber das große Zielbild, wo wir hinwollen, sollten wir uns erarbeiten. Wenn wir schon kleine Trippelschritte machen, um vorwärts-zukommen, sollten wir wenigstens in die richtige Richtung laufen und nicht zwei Schritte vor, einer zurück, oder mal nach rechts, mal nach links.
Was zählt zu diesem Zielbild?
Augurzky: Im Großen und Ganzen sollten wir schauen, dass wir wegkommen vom anbieterzentrierten hin zum patientenorientierten Gesundheitssystem. Dazu müssen wir die Patienten unter anderem mithilfe digitaler Werkzeuge auf Augenhöhe zu den Leistungserbringern bringen. So kann die Nachfrageseite Marktmacht aufbauen und sich in den Mittelpunkt setzen.
Außerdem müssen wir Gestaltungsfreiheit auf der regionalen Ebene ermöglichen, Einheiten wie Landkreise oder Metropolregionen. Dort, wo die Probleme entstehen, müssen sie auch gelöst werden. Nach dem Motto: Vertrauen schenken, Ergebnisse kontrollieren. Für letzteres brauchen wir wieder die ungeliebte Transparenz. Und wir brauchen regional eine Person bzw. Einrichtung, die die Verantwortung für den gesamten Behandlungspfad übernimmt – über die Sektoren hinweg. Heute besteht eine Art kollektiver Nicht-Verantwortung für die Ergebnisse. Schließlich müssen die Vergütungssysteme so geschaffen sein, dass sie Gesunderhaltung und ressourcenschonende, nutzenbringende Behandlungen fördern.
Das tut das jetzige Vergütungssystem nicht?
Augurzky: Die derzeitigen Vergütungssysteme setzen eher den Anreiz, viel Leistung zu erbringen. So sinnvoll es ist, Leistungsbereitschaft zu fördern – wir tun damit auch zu viel des „Guten“. Da hat dann eine hochbetagte, pflegebedürftige Person täglich 15 verschiedene Arzneimittel einzunehmen und keiner blickt mehr durch, ob das in der Summe überhaupt sinnvoll ist. Mit einer elektronischen Patientenakte könnten wir dies vielleicht analysieren. Aber wie gesagt, wer will schon Transparenz? Da werden Behandlungen stationär erbracht, weil sie ambulant nicht kostendeckend erbracht werden können. Da werden Privatpatienten „überbehandelt“; schadet ja nicht. Tatsächlich ist es aus Sicherheitsaspekten auch besser, lieber etwas mehr als zu wenig zu machen. Wenn aber die Ressourcen knapp sind, müssen wir schauen, wo ihr Einsatz den größten Nutzen stiftet.
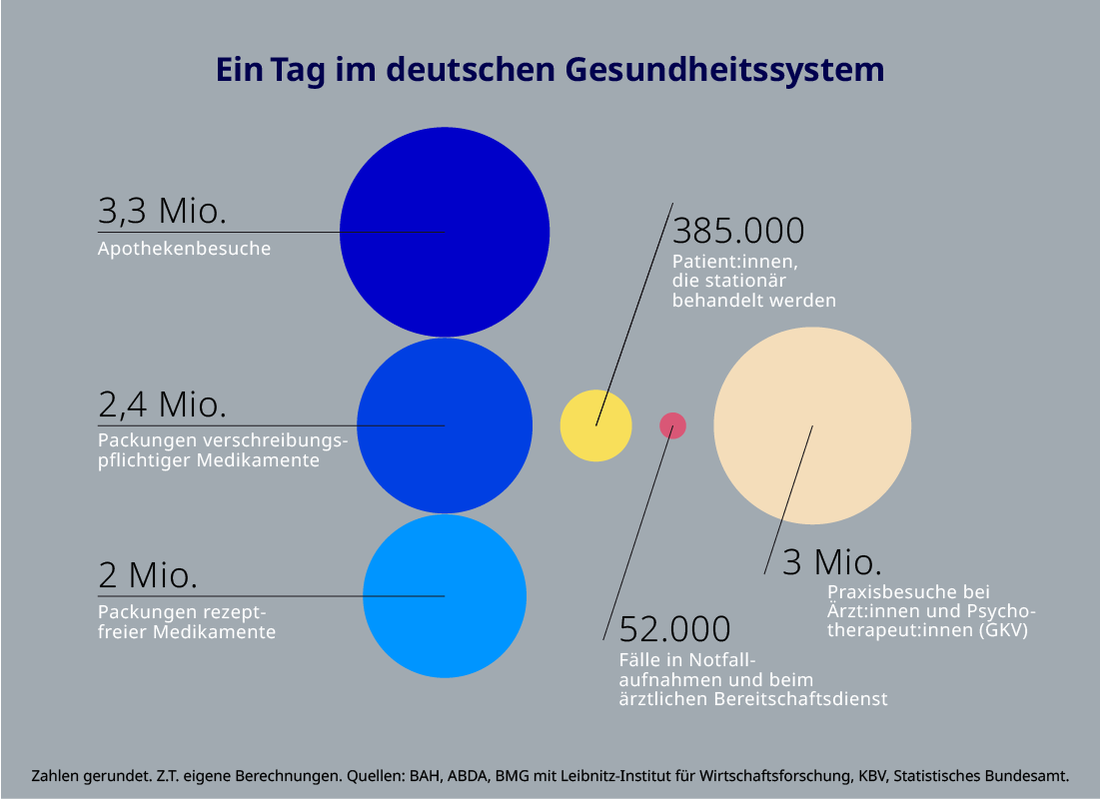
In Ihrem Vorschlag geht es darum, Regionen die Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung zu übergeben ...
Augurzky: … und sie dabei in einen gesunden Wettbewerb zu setzen.
Ist das dann das Ende der freien Arztwahl?
Augurzky: Das Gegenteil braucht es. Es braucht die freie Arztwahl als Korrektiv. Gestaltungsfreiheit auf regionaler Ebene geht nicht ohne Kontrolle. Kontrolle der Ergebnisse, aber auch Kontrolle durch Wettbewerb, indem die Menschen frei wählen können, wo beziehungsweise in welcher Region sie sich behandeln lassen wollen. Wenn eine Region schlechte Ergebnisse liefert, verliert sie Patienten und damit auch Budget, während eine erfolgreiche Region gewinnt. Dazu müssen die Regionen so geschnitten sein, dass Ausweichoptionen für die Menschen in erreichbarer Nähe sind.
Leidet nicht die Qualität, wenn eine Region „einfach so“ ein festes Budget bekommt?
Augurzky: So ist es. Dann leidet die Qualität sogar massiv. Ein Budget „einfach so“ zu übertragen, führt da-zu, dass am Ende keine oder minderwertige Leistung erbracht wird. Es kommt schnell zu Ermüdungserschei-nungen bei den Leistungserbringern mit der Folge von Wartelisten und schlechtem Service. Daher muss die Region, die ein Budget erhält, im Wettbewerb mit Nachbarregionen stehen, wofür wir die freie Wahl des Leistungserbringers brauchen. Und wir brauchen die Kontrolle der Ergebnisse, der Versorgungsqualität: Die heute gelebte Kostenkontrolle durch den Medizinischen Dienst würde einer Qualitätskontrolle weichen.
Gesundheitswettbewerb der Regionen also, gibt es dazu Erfahrungen?
Augurzky: Ja. Regionen, die einen „wettbewerblichen“ Budgetansatz gewählt haben, schaffen den Anreiz für die Leistungserbringer, Qualität zu liefern. Beispielsweise gibt es ein Stadtteil in Madrid, der diesen Weg erfolgreich gegangen ist. Eine Region, die dagegen ein bedingungsloses Budget erhält, verfällt dem Tief-schlaf. Auch dieses Beispiel gibt es in einem anderen Stadtteil von Madrid. Wenn das Budget sektorenübergreifend angelegt ist, wird auch die Versorgung sektorenübergreifend erfolgen: ambulante Behandlung, wenn möglich, stationär, wo nötig – oder sogar digital, wenn möglich.
Auch Präventionsangebote lohnen sich für alle Beteiligte: lieber gesund und ohne Behandlungskosten als krank und kostenintensiv. Aber wie für alle Vergütungssysteme gilt auch hier: Unerwünschte Nebenwirkungen müssen beobachtet und ggf. nachjustiert werden. Am besten ist es, wenn wir verschiedene Regionalmodelle ins Rennen schicken, sie auf ihre Vor- und Nachteile hin evaluieren und am Ende von den Besten lernen. Kurz: Gestaltungsspielräume schaffen, ausprobieren, aus Fehlern lernen, besser machen.
Grafik: Shutterstock


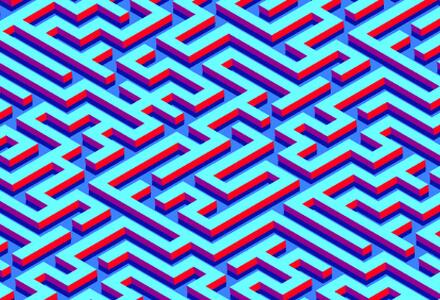





Kommentare