
Dr. Mira Faßbach ist Urologin an einer Duisburger Klinik. Max Tischler Dermatologe in einer Dortmunder Hausarztpraxis. Gemeinsam sind sie die Sprecher:innen des Bündnisses Junge Ärzte. Wie sie die Versorgung, die Prävention und ihre Rolle im Gesundheitswesen der Zukunft sehen.
Frau Faßbach, Herr Tischler, Sie haben im Bündnis Junge Ärzte viel Kontakt zu Kolleg:innen. Geben Sie uns bitte einen Einblick: Was erleben junge Ärzte zurzeit? Welche Themen beschäftigen sie?
Mira Faßbach: Wir spüren nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wenn die Belegungszahlen in den Kliniken hoch sind, werden vor allem die jungen Ärzte umverteilt, teilweise schnell noch umgeschult. Sie müssen häufig einspringen, wo Not am Mann ist. Ein weiterer Effekt war und ist, dass durch das Verschieben vieler planbarer Operationen und Untersuchungen die vorgeschriebenen Eingriffszahlen für den Weiterbildungskatalog, beispielsweise für den Facharztabschluss, nicht erreicht werden konnten.
Und natürlich fehlt den jungen Kolleg:innen damit dann auch die Übung in diesem Bereich. Auch vor Corona war ein großer Kritikpunkt der jungen Ärzt:innen, dass Weiterbildung oft nicht strukturiert stattfindet und außerhalb der regulären Arbeitszeit stattfindet. In einer Umfrage des Bündnis Junge Ärzte gaben mehr als 70 Prozent unserer Mitglieder an, dass sie mehr als zehn Überstunden pro Woche machen.
Wenn Sie nach vorne schauen: Wie sieht die Zukunft in Ihrem Fachgebiet bestenfalls aus?
Mira Faßbach: Wir stehen zurzeit vor dem Problem einer immer älteren Patientenschaft und einer Überalterung der Ärzteschaft. Das heißt, wir brauchen zukünftig viele neue Fachärztinnen und Fachärzte. In meiner eigenen Zukunftsvision wurde dieser Bedarf erkannt und man hat ihm Rechnung getragen: nicht nur mit gezielter Versorgungsplanung, sondern auch mit Planung der Ausbildungskapazitäten.
Es gilt zu überlegen, wie viele Fachärzte es in einer Region braucht und welche Mindestzahl bestimmter Eingriffe es mit Blick auf eine bestimmte Population braucht. Das betrifft auch die Krankenhausplanung: Wie viele Herzkatheterplätze braucht man in einer Stadt einer bestimmten Größe wirklich – sind drei zu viel? Oder zu wenig? Und dann ist das natürlich alles auch so kalkuliert, dass die ausreichenden Fachärzt:innen ausreichend Zeit haben. Für die Patientinnen und Patienten, für alle anfallenden Verwaltungsaufgaben, aber auch für die Weiterbildung junger Fachärzt:innen.
Max Tischler: Momentan ist unsere Arbeit sehr reaktiv: Der Patient kommt mit einem Problem, der Arzt behandelt es. In der Dermatologie – und sicher auch in einigen anderen Bereichen – wird die präventive Beratung zukünftig eine größere Rolle einnehmen. Bei uns ist es beispielsweise das Hautkrebsscreening. Das nehmen noch immer viel zu wenig Menschen in Anspruch, und dazu gehört auch, dass wir die Leute umfassender aufklären als bisher, wie sie sich vor Hautkrebs schützen können.
Durch den Schwerpunkt auf der Prävention werden wir die Gesundheitskompetenz der Patienten verbessern, da kann man meiner Meinung nach noch sehr viel mehr tun als bisher. Zahnärzte kriegen das ja schon ganz gut hin.
Wie könnte so eine Welt der Prävention aussehen?
Max Tischler: Wir werden zukünftig die Betriebsmedizin stärken, um uns mehr um die Leute kümmern zu können, die gerade in der Ausbildung sind oder schon im Berufsleben stehen. Auch an Grundschulen und weiterführenden Schulen werden wir sehr viel präsenter sein als heute, schließlich leiden viele Menschen im Alter unter den Lichtschäden, die sie im Kindes- und Jugendalter erlitten haben.
Aber auch bei anderen Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder auch bei ganz anderen Themen wie gesunder Ernährung und Bewegung können wir viel erreichen, indem wir den Kindern und Jugendlichen schon eine Menge Wissen mit auf den Weg geben. Das ist moderne Prävention, so können wir verhindern, dass sich zahlreiche Krankheiten überhaupt erst entwickeln.
Welche Rolle wird die Digitalisierung im Zukunft spielen?
Mira Faßbach: Da gibt es viele spannende Projekte und Funktionen, die teils ja auch schon in Planung sind. Ich fürchte, dass es tatsächlich noch einige Zeit dauern wird, bis wir die elektronische Patientenakte vollumfänglich und alltäglich nutzen, die von den Krankenkassen zwar verwaltet wird, auf der aber jede:r Patient:in den Zugriff auf die eigenen Daten steuern kann. Für uns Ärzt:innen bedeutet die E-Akte eine enorme Zeitersparnis: Wir haben sofort den Überblick über alle bisherigen Diagnosen und Behandlungen und müssen nicht wertvolle Arbeitszeit damit verbringen, bei verschiedenen behandelnden Ärzt:innen und Kliniken Unterlagen anzufordern.
Auch der Patient profitiert: Wir können auf unnötige Doppeluntersuchungen verzichten. Das spart ihm Zeit und der Klinik Kosten. Und auch für die Forschung sind die elektronischen Patientendaten sehr hilfreich: Wenn Patient:innen einwilligen, dass ihre Daten für Forschungszwecke verwendet werden dürfen, können wir beispielsweise bisher unbekannte Muster erkennen bei Krankheitshäufigkeiten.
Neben der elektronischen Patientenakte werden wir zukünftig zahlreiche digitale Lösungen haben, die individuell eingesetzt werden müssen. Zum Beispiel finde ich es toll, wenn jemand nach einer OP zum Folgegespräch kommt und ich ihm Links und Aufklärungsbögen auf sein Smartphone schicken kann. Das ist für mich ein kleiner Extraaufwand, aber ein großer Informationsgewinn für den Patienten. Ich verspreche mir insgesamt von der Digitalisierung viel Entlastung.
Max Tischler: In der Dermatologie werden digitale Tools zum Einsatz kommen, bei denen beispielsweise künstliche Intelligenz erkennt, ob ein Muttermal bösartig ist. Das Gerät screent dann zum Beispiel die 300 Muttermale auf der Haut eines Patienten und markiert die zehn bis zwanzig, die ich mir als Facharzt nochmal genauer anschauen sollte. Wir werden auch eine Technik haben, die in der Lage ist, Frühtumore in einem Stadium zu erkennen, das heute noch nicht möglich ist.
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 20, 30 Jahren in der Hautkrebsdiagnostik einen anderen Goldstandard haben als heute. Generell haben wir bei der Digitalisierung enormen Nachholbedarf. Man muss sich ja nur mal anschauen, wie wir privat digital arbeiten und wie in einer Arztpraxis. Wenn die E-Akte kommt und all die anderen Erleichterungen in der Dokumentation, wird uns das freie Zeit einbringen.
In der nehmen wir aber nicht mehr Patienten an, sondern nutzen sie für Fortbildungen, den Austausch unter Kollegen oder einfach für die bessere Betreuung der Bestandspatienten. Das Arzt-Patienten-Gespräch wird in Zukunft einen höheren Wert erhalten.
Zur Digitalisierung gehört auch die Telemedizin, die ja zum Teil schon praktiziert wird. Ist das ein Konzept mit Zukunft?
Mira Faßbach: Das hat sich durch die Corona-Pandemie noch einmal intensiviert, aber ich sehe die Telemedizin nicht alleine als Hilfsmittel sondern auch als zweischneidiges Schwert: Bei Patienten, die man schon lange kennt, ist das sicher eine gute Möglichkeit, um im hektischen Alltag schnell mal eine Kleinigkeit wie eine Medikamentenanpassung zu besprechen. Der Goldstandard ist aber der persönliche Patientenkontakt.
Man muss einen Patienten kennenlernen, ihn einschätzen können, um eine therapeutische Beziehung aufbauen zu können. Nur, wenn diese Vertrauensbasis da ist, erzählt mir mein Patient auch, dass ihm die Depression gerade wieder schwerer zu schaffen macht. Oder dass er die Medikamente gegen Bluthochdruck, die ich ihm verschrieben habe, gar nicht nimmt, weil sein Bruder dieses Mittel nicht gut vertragen hat.
Das persönliche Arzt-Patienten-Verhältnis wird Kern der Therapie bleiben. Eine erfolgreiche Behandlung findet nur statt, wenn das Vertrauensverhältnis da ist. Dafür scheint mir ein persönliches Kennenlernen unumgänglich. Zudem finde ich auch wichtig, dass wir nicht noch mehr Vorgaben von außen bekommen, das geht häufig zu Lasten des individuellen Verhältnisses zum Patienten.
Max Tischler: Das ist für mich auch ein Grund, weshalb ich mich mit meiner eigenen Hautarztpraxis selbständig machen werde: Man hat viel mehr Kontakt und eine ganz andere Beziehung zum Patienten.
Welche Hürden müssen auf dem Weg in die Zukunft genommen werden?
Mira Faßbach: Wir brauchen mehr konstruktiven Dialog zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer. Bessere Kooperationen, bessere Durchlässigkeit, bessere Bezahlung. Wie wir das hinkriegen? Ich weiß es nicht. Ein Anfang könnte sein, sich Projekte anzuschauen, die im ländlichen Raum zum Teil schon erfolgreich umgesetzt werden.
Dort gibt es Case-Manager, Community-Nurses oder Netzwerke für Pflege und Grundversorgung. Die müssen natürlich finanziert und durchdacht werden. Insgesamt wünsche ich mir sehr viel mehr Kooperationen und Koordination: zwischen den einzelnen Fachbereichen, zwischen Kliniken und niedergelassenen Ärzten. Es profitieren alle davon, wenn der Patient sich geleitet fühlt in einer Art Netzwerk. Die Digitalisierung kann hier wirklich einen großen Beitrag leisten, weil sie so vieles vereinfacht, auch das Netzwerken.
Was gehört für Sie auf keinen Fall in Ihre Zukunftsvision?
Mira Faßbach: Eine stärkere Privatisierung. Ich finde es schwierig, wenn aus Versichertengeldern Erlöse und Profit generiert werden. Gesundheitsfürsorge sollte ähnlich wie die städtische Feuerwehr Allgemeingut sein.
Wie steht es um das Verhältnis von Familie und Beruf? Welche Möglichkeiten werden junge Ärzte zukünftig haben?
Mira Faßbach: Da sind wir hoffentlich bald ein gutes Stück weiter. Der Wunsch nach einer erfüllenden beruflichen Tätigkeit, in der die Arbeitszeit effektiv genutzt werden kann, gepaart mit genug Zeit für Familie, Freizeit und auch Fortbildung ist einer, der schon jetzt groß ist unter den jungen Ärzt:innen. Die Modelle der flexiblen Arbeitszeiten sind momentan je nach Klinik sehr individuell, und das nicht unbedingt im positiven Sinne.
Ich stelle mir vor, dass wir da bald auf dem Level sind, dass Familie nicht als Frauenthema gilt, mehr Frauen Leitungspositionen besetzen, es eine hohe Akzeptanz der Elternzeit für Männer und Frauen sowie Programme für strukturierte Wiedereinstiege gibt. Schwangerschaft und Geburt sind normale Stationen und sollten kein Karrierehindernis mehr sein, Lebensläufe sind nicht mehr nur in geradlinig schön, sondern auch mit Umwegen und Nebenwegen. Und Teilzeit ist ein Konzept für alle, nicht nur für Menschen mit Kindern.
Max Tischler: Ich arbeite derzeit 80 Prozent und glaube nicht, dass ich in meiner eigenen Praxis 100 Prozent arbeiten werde. Und das werden meine Angestellten genauso tun, es wird auch keine Vorgaben geben, dass „Teilzeit“ nur 50 Prozent oder mehr sein kann. Wenn jemand für eine gewisse Zeit nur 20 Prozent arbeiten kann, dann wird das möglich sein.
Für all diese Anliegen, bei denen man in der Ärzteschaft bisher nicht bereit war, Lösungen zu finden, wird es neue Wege geben. Eine leitende Position in der Klinik mit einer 60-Prozent-Stelle zu besetzen wird genauso funktionieren wie zwei Ärzt:innen, die sich einen Chefarztposten teilen – wenn sie dazu noch zwei unterschiedliche Sichtweisen haben, ist das sehr willkommen.
Es wird zukünftig nicht mehr so sein, dass Forschung und Fortbildung als eine Art Hobby gelten, die außerhalb der Arbeitszeit stattfinden müssen, dafür ist Platz während der Arbeit, auch, wenn die „nur“ Teilzeit ist. Ich denke, dass die Teilzeitstellen massiv zunehmen werden, wir merken, wie viel Wert die jungen Ärzt:innen auf eine gute Work-Life-Balance legen.
Foto: Santiago Nunez / Photocase





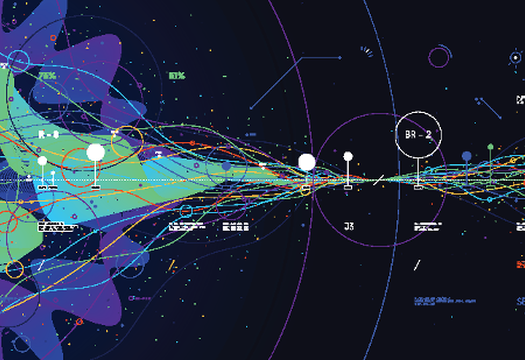


Kommentare