Gesundheitsversorgung nah an der Lebenswelt der Menschen geplant, dazu eine umfassende Versorgung durch multiprofessionelle Teams – das ist die Idee von regionalen Gesundheitszentren. Die Robert Bosch Stiftung fördert 13 solcher Zentren in ganz Deutschland. Die so genannten PORT-Zentren (Patientenorientierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung) verstehen sich als Kern einer neu zu gestaltenden tragfähigen Primärversorgung. Und als Ergänzung. Ein Gespräch mit Irina Cichon und Jannis Feller von der Robert-Bosch-Stiftung.
Wieso unterstützt die Robert Bosch Stiftung Modelle für regionale Primärversorgungszentren?

Cichon: Unser Gesundheitssystem wird den heutigen Anforderungen nicht gerecht: Es ist immer noch auf die Akutversorgung ausgerichtet, sektoral und zersplittert und tut sich in der Begleitung von chronisch und mehrfach erkrankten Menschen schwer. Solche Fälle werden das Krankheitsspektrum aber immer stärker prägen.
Feller: In den kommenden zehn Jahren wird ein demografischer Ruck durch Deutschland gehen. Die geburtenstärksten Jahrgänge – 1955 bis 1965 – gehen in den Ruhestand. Wir haben also nicht nur immer mehr ältere Leistungsnachfragende, sondern auch immer weniger Ärzt:innen, Pflegende und weitere gesundheitlich Tätige. Das Angebot bricht zunehmend weg, während die Nachfrage steigt.
Cichon: Unser Gesundheitssystem hat keine befriedigenden Antworten auf all unsere Herausforderungen: die Alterung der Gesellschaft, der Klimawandel, die Digitalisierung, … Das war schon vor der Pandemie klar, es wurde nur noch schonungsloser offengelegt: die fehlende Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland, fehlende Public-Health-Ansätze, der schlecht ausgestattete öffentliche Gesundheitsdienst, der eklatante Mangel an Daten durch rudimentäre Digitalisierung, ungeklärte Versorgungszuständigkeiten, Überforderung im Alten- und Pflegebereich, ausbaufähige Gesundheitskompetenzen in der Bevölkerung oder mangelnde Interaktion zwischen Gesundheits- und Sozialbereich.
Das ist eine lange Liste… Wie sehr beschäftigt das die Menschen jenseits von Fachkreisen? Sie haben 2018 im ganzen Land Bürgerdialoge geführt, um zu erfahren, was die Menschen über unser Gesundheitssystem denken und was sie erwarten. Was kam dabei heraus?
Cichon: Das wichtigste Ergebnis von „Neustart! Reformwerkstatt für unser Gesundheitswesen“ war: Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen. Die Bürger:innen wünschen sich einen niederschwelligen Zugang zu einer umfassenden, ganzheitlichen Betreuung. Doch allein schon an der Digitalisierung merken sie, dass an ihren Bedürfnissen vorbeigeplant wird. 73 Millionen Menschen sind in Deutschland gesetzlich krankversichert – und es wird oft an ihren Bedarfen und Wünschen vorbeigeplant: Wie lange können wir uns das noch erlauben?
Der Mensch im Mittelpunkt, inwiefern können das die regionalen Primärversorgungszentren, die Sie fördern, für sich in Anspruch nehmen? Was ist der Unterschied zur hausarztzentrierten Versorgung?
Feller: Der entscheidende Unterschied in der regionalen Primärversorgung ist die Berufsgruppenzusammenarbeit in den Zentren und der dadurch ermöglichte ganzheitliche Blick. In so einem Zentrum arbeiten zum Beispiel eine Hausärztin, ein Kinderarzt, Physiotherapeut:innen, außerdem neue Berufe wie Case Manager:innen, Care Manager:innen und tauschen sich kontinuierlich untereinander aus.
Das hat also auch eine sozialmedizinische Komponente: Wenn viele draufschauen und miteinander reden, fällt es auch leichter auf, wenn hinter einer Problematik nichts Medizinisches steckt. Zudem sind die Angebote in den Zentren zielgerichtet auf die jeweiligen regionalen Bedarfe zugeschnitten. All das setzt den Menschen in den Mittelpunkt.
White Paper für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem
Gemeinsam aus der Pandemie lernen: Eine Expertengruppe aus Patientenorganisationen, Wissenschaft, Medizin und Pflege macht sich für Reformen stark und bringt sich mit gemeinsamen Vorschlägen in die gesundheitspolitische Diskussion ein.
Inwiefern bildet man die regionale Gesundheitsversorgung besser ab?
Feller: Eines unserer Zentren liegt beispielsweise in einer zersiedelten, ländlichen Region im Schwäbischen. Dort wohnen viele junge Familien. Es war also klar, dass dieses PORT-Zentrum auch eine Kinder- und Jugendmedizin hat, außerdem, auf Wunsch der Bevölkerung, eine große Physioabteilung und eine Unfallchirurgie. In Berlin-Neukölln dagegen liegt ein großer Schwerpunkt auf der Gesundheits- und Sozialberatung sowie der Vernetzung mit ehrenamtlichen Multiplikatoren aus der Community. Hier hat nur jeder Zweite Deutsch als Muttersprache, Gesundheitsinformationen müssen also überhaupt erst einmal zugänglich gemacht und vermittelt werden.
Ohne Ihre finanzielle Förderung würden diese multiprofessionellen Versorgungszentren nicht funktionieren – warum?
Feller: Weil sie Profile und Leistungen anbieten, die das jetzige System nicht abdeckt: neue ambulante Funktionen wie Case- und Care-Management beispielsweise. Aber auch die notwendige Aus- und Fortbildung für interprofessionelle, multiprofessionelle Zusammenarbeit wird bislang nicht bezahlt, geschweige denn angeboten.
Man muss für solch ein Arbeiten geschult sein, sonst rutscht man leicht in ein klassisches Delegationsverhältnis ab. Nicht zuletzt finanzieren wir schlichtergreifend die Zeit, die es braucht, damit sich die verschiedenen therapeutischen Berufe miteinander austauschen. Fallkonferenzen, aber auch sprechende Medizin. So etwas ist im jetzigen System nicht vorgesehen.
Wie funktioniert dieser Austausch unter medizinischen Fachkräften, digital?
Feller: Es läuft sowohl niedrigschwellig, also im Türrahmen, als auch strukturiert auf Fallkonferenzen. Was wir in allen Zentren sehen: Sie leisten sehr gute Arbeit, aber alle tun sich schwer, digitalisierte übergreifende Kanäle zu etablieren. Dass beispielsweise Ärzt:innen virtuell mit Community Health Nurses kommunizieren können. Das geht heute überhaupt nur, wenn die Pflegefachkraft in der gleichen Praxis angestellt ist wie der Arzt oder die Ärztin. Nur dann dürfen sich beide bei einem Hausbesuch virtuell verbinden. Solche technischen und regulatorischen Schwierigkeiten liegen außerhalb der Macht der Zentren.
Cichon: Es gibt viele rechtliche Hindernisse für eine umfassende patientenorientierte Primärversorgung, die klar als eine eigenständige kooperative und multiprofessionelle Versorgungsform sozialgesetzlich – z. B. im SGB V sowie in den nachgeordneten Vertragswerken – verankert werden sollte. Auch kommunale und regionale Handlungsfähigkeit sollte rechtlich gestärkt werden. Denn aktuell können Kommunen die örtliche Gesundheitsversorgung nur bedingt mitgestalten und bundeseinheitliche Vorgaben werden den lokalen und regionalen Bedürfnissen oft nicht ausreichend gerecht. Außerdem müssen wir die multiprofessionelle Leistungserbringung regeln.
Neue Aufgabenprofile führen zu berufs- und haftungsrechtlichen Fragestellungen, etwa für Community Health Nurses, die Patientinnen und Patienten aufsuchen. All das geht nicht ohne Änderungen u.a. im SGB V. Laut Koalitionsvertrag soll die regionale Versorgung attraktiv gemacht werden. Doch ohne rechtliche Stärkung bleibt dies nur eine Vision. Wir dürfen uns nicht länger hinter der Ausrede verstecken, dass etwas „rechtlich nicht geht“. Vorschläge für einen „Neustart für das Gesundheitsrecht“ liegen auf dem Tisch.
Ihre Primärversorgungszentren setzen viel stärker auf Prävention und umfassende Betreuung auch in frühen Stadien von Erkrankungen. Gibt es Modellierungen, ob sich das auf die Dauer rechnet?
Feller: „There ist no glory in prevention“ – den Wert der Prävention kann man erst nach sehr langen Zeiträumen erfassen. Insofern haben wir bislang nur anekdotische Evidenz.
Cichon: Gerade in der Pandemie zeigte sich der Mehrwert der Zentren. Sie hatten die Räume und das Personal, um sofort Corona-Sprechstunden, Testangebote und psycho-soziale Beratung anzubieten.
Feller: Außerdem war der Schritt zur Nachbarschaftsarbeit niederschwellig. Viele Zentren haben ohnehin Ehrenamtsangebote und konnten schnell vom Gesundheitsangebot zur Einkaufshilfe wechseln. Das sind Hubs für Gesundheit. Die Vernetzung mit Schulen, Bibliotheken, Landratsämtern oder Multiplikatoren hilft auch für Gesundheitsinformation. In der Pandemie konnte man beispielsweise schnell Fehlinformationen abfangen– und im eigenen Zentrum, wie an einigen Standorten, eine Impfstraße aufbauen.
Stoßen Sie auch auf Widerstand? Welche Erfahrungen machen Sie in der Zusammenarbeit mit Krankenhäusern?
Feller: Es gibt immer wieder einzelne Akteure, die ein PORT-Zentrum als Konkurrenz sehen. Aber es sind Einzelfälle. Insgesamt zeigen unsere Evaluationen, dass sowohl die Patient:innen als auch das beteiligte Gesundheitspersonal sehr zufrieden sind. Und dadurch, dass wir dezidiert Stellen haben, die das Zusammenspiel steuern und koordinieren, gelingt auch der Brückenschlag nach außen: Das mündet dann beispielsweise in ein strukturiertes Entlassmanagement mit Krankenhäusern.
Cichon: Ganz wichtig ist, die Bevölkerung gut aufzuklären und in die Entscheidungsfindungen altiv miteinzubeziehen. Gerade auch bei der Ambulantisierung von Krankenhausleistungen. Viele wollen ihr örtliches Krankenhaus behalten, obwohl sie selbst bei etwas Ernstem in die nächste Großstadt fahren. Wenn wir die Menschen mit einbeziehen, auch in die Planung, können wir vieles voranbringen. Die Menschen sind zur Mitgestaltung bereit, das haben unsere Bürgerdialoge von „Neustart“ gezeigt.
Was mich stetig wundert, ist eine unglaubliche Lücke zwischen all den Diskussionen und Vorschlägen auf Tagungen und Kongressen und dem, was im System tatsächlich umgesetzt ist. Wir diskutieren und kommen nicht wirklich ins Tun. Worauf sollen wir als Gesellschaft noch warten? Viele Vorschläge und Ideen liegen auf dem Tisch, wir brauchen nun Mut für tragfähige, zukunftsgerichtete Veränderungen und Entschlossenheit zum Handeln.






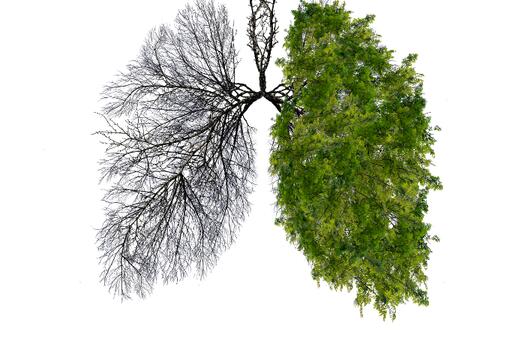

Kommentare