Was ist ein digitaler Zwilling in der Medizin?
Bezogen auf Menschen ist ein digitaler Zwilling das virtuelle Abbild eines Patienten. Also eine Software, die möglichst viele Daten, die für seine Krankheit relevant sind, zusammenführt und mit entsprechenden Algorithmen analysiert. Ein digitaler Zwilling ist niemals das vollständige Abbild eines Menschen – er bezieht sich immer auf eine bestimmte Problemlage.
Und wie sieht so ein Zwilling aus?
Für die klinischen Nutzer:innen als Computerprogramm mit einem bedienerfreundlichen Dashboard.
Welche Daten fließen in den digitalen Zwilling ein?
Ärzt:innen geben in den medizinischen digitalen Zwilling patientenrelevante Daten ein wie Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen, außerdem Labor- und Bildgebungsdaten. Bereits hinterlegt sind klinische Leitlinien zur jeweiligen Erkrankung, Therapiepfade, sowie weiterführendes Wissen aus der jeweiligen Population – und auch gesundheitsökonomische Modellierungsdaten.
Der digitale Zwilling beinhaltet also auch Daten von anderen Patient:innen?
Nicht im Sinn von erkennbaren Personendaten – aber pseudonomisierte Informationen aus der Diagnostik, dem Krankheitsverlauf und der Therapie anderer Betroffener. Ärzt:innen bekommen also nicht nur angezeigt, welche Medikamente bei bestimmten Diagnoseparametern laut Leitlinien eingesetzt werden können, sondern auch: Wie wirkte welches Medikament bei vergleichbaren Patient:innen? Unser Zwilling führt das darüber hinaus noch mit der Frage der Kosten zusammen: Ein initial teureres Medikament kann unterm Strich günstiger sein, wenn der Therapieerfolg damit höher ist. Es geht also auch um intelligente Gesundheitsausgaben.
Woher bekommen Sie die Daten anderer Patient:innen – das „Kohorten-Wissen“?
Wir sind auf kooperierende Universitätskliniken angewiesen. Es ist ein großes Problem, dass wir in Deutschland noch nicht gut auf Daten für die Forschung zurückgreifen können. Das macht es schwierig. Es gibt hierzulande inzwischen die Medizininformatik-Initiative, welche Patient:innendaten aus Kliniken bundesweit vernetzen will. Auf europäischer Ebene gibt es nun den European Health Data Space.
Ersetzt der digitale Zwilling die ärztliche Entscheidung?
Definitiv nicht. Er führt Daten, die bislang zeitlich und örtlich verteilt und teils unstrukturiert vorlagen, zusammen, analysiert sie und zeigt den Ärzt:innen dann an: Was sagen die Leitlinien? Was zeigen die Outcomes anderer Patient:innen? Und was bedeutet es auf der Kostenseite? Entscheiden tut weiterhin der Mensch.
Was unterscheidet den digitalen Zwilling von computergestützten Entscheidungssystemen für Mediziner:innen, die es ja schon jahrelang gibt?
Der digitale Zwilling führt mehr Daten zusammen, strukturierter und mit mehr Semantik dahinter.
Wohin wird sich der digitale Zwilling entwickeln?
Die große Chance liegt im Einbeziehen von Kohortenwissen: Je mehr Erfahrungsbilder wir von anderen Patient:innen mit derselben Krankheit haben, desto bessere Therapievorschläge kann das System machen. Dieses Wissen wird die Medizin deutlich verbessern.
Der andere Punkt ist, dass das biomedizinische Wissen rasant wächst: Kein Mensch kann heute mehr die vielen tausend Parameter, die eine Erkrankung bestimmen, überblicken. Aber wir haben die Rechenleistung, um sie zu erfassen, und die Algorithmen, um darin Muster zu erkennen. Digitale Zwillinge werden also immer detaillierter werden und helfen, dass individuelle Patient:innen zur bestmöglichen Prävention, Diagnose und Therapie kommen.
Sieben Fraunhofer-Institute haben sich im Leitprojekt MED²ICIN zusammengeschlossen, um ein holistisches digitales Patientenmodell zu entwickeln. Der erste Prototyp wurde 2021 am Universitätsklinikum Frankfurt am Main für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) eingeführt und wird derzeit evaluiert. In ihm gingen die Daten von mehr als 600 Betroffenen mit 170 verschiedenen Parametern ein.





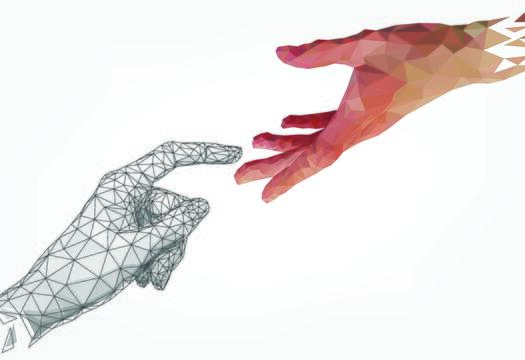


Kommentare